Handwerk
Historie
Am Anfang waren Himmel und Erde. Den ganzen Rest haben wir gemacht. So lautet der Slogan, mit dem das Handwerk heute wirbt.
Bis dahin hat das Handwerk einen sehr langen Weg hinter sich. Zu Beginn stand die Verarbeitung von Lebensmitteln, die Herstellung von Kleidung, Geräten und Bauten aus Holz lediglich für den eigenen Bedarf. Die einzigen Ausnahmen waren die Steinhauer und Baumeister, die sich mit ihrer Kunst über Grenzen hin weg bewegten. Dies hatte zur Folge, dass sich die Stilentwicklungen der jeweiligen Handwerker verbreiteten. Erst als im Hochmittelalter die Bildung der Städte begann verlagerte sich der Schwerpunkt auf den Verkauf der angefertigten Waren.


Die Waren der einzelnen handwerklichen Könner wurden auf Märkten aber auch in den Werkstätten angeboten. Aufgrund dieser Veränderung wurde die Ware nicht nur für Aufträge sondern auch für eine stete Produktion gefertigt. Die kulturelle Entwicklung spiegelte sich auch in den Arbeiten wieder.
Das Handwerk wurde durch künstlerische Elemente verfeinert, was besonders bei der Goldschmiede und der Zinngießerei zu sehen war. Aber auch die Arbeitsmittel veränderten sich im Laufe der Zeit. Schmiede oder Töpfer benötigten schon damals eine umfangreichere Ausrüstung. Dieser Wandel im Bereich der Arbeitsmittel revolutionierte sich nochmals durch die Technisierung.
Der Einsatz von Maschinen und technischen Hilfsmitteln erreichte nun alle Bereiche des Handwerks. Bis heute unterliegen alle Handwerke einer immerwährenden Modernisierung und Anpassung an Bedarf und auch Möglichkeiten.

Bis auf wenige, vom Zunftzwang befreite Meister, schlossen sich die Handwerker gegen Ende des Mittelalters zu selbstverwalteten Zünften ihres Gewerkes zusammen. Seither wurden auch die Vorgaben durch die Handwerksrolle der jeweiligen Zeit und politischen Situation angepasst. Interessante und Detaillierte Informationen zum historischen Handwerk kann man heute noch auf mittelalterlichen Märkten und bei Vorführungen in einem der zahlreichen Museumsdörfer erhalten und dort das alte Handwerk bewundern.
Berufe des Handwerks
In Deutschland gibt es fast 160 Berufe im Handwerk. Diese reichen von A wie Augenoptiker bis Z wie Zweiradmechaniker. Nach der Handwerksordnung sind die Handwerke unterteilt sind in 41 zulassungspflichtige Gewerbe, 53 zulassungsfreie und 57 handwerksähnliche. Sie definieren sich nach den dort ausgewiesenen Bereichen.
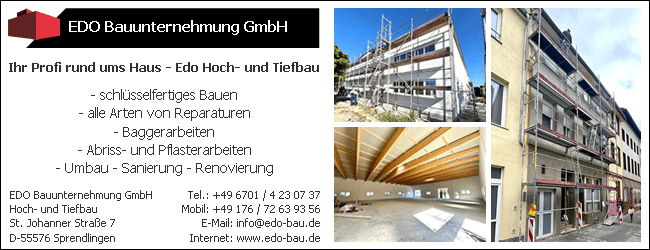
Dementsprechend bietet das Handwerk eine Fülle von Beruflichen Perspektiven. Genaue Informationen bieten hier z.B. www.berufsinfo.org und www.handwerksberufe.de oder eine der vielen Handwerkskammern und Fachverbände.
Die Fachrichtungen werden grob unterschieden in die Bereiche Bau- und Ausbaugewerbe, Elektro- und Metallgewerbe, Holzgewerbe, Bekleidungs-, Textil- und Ledergewerbe, Lebensmittelgewerbe, Gesundheit und Körperpflege, Chemisches- und Reinigungsgewerbe sowie Glas-, Papier-, Keramik und sonstige Gewerbe.


Diese Sammelbegriffe geben einen groben Einblick in die im Handwerk möglichen Berufsfelder. Die Ausbildung im Handwerk findet im Ausbildenden Betrieb und in der Berufsschule statt und dauert zwischen 2 bis 3 ½ Jahre. Der berufliche Abschluss, die Gesellenprüfung, wird durch den unabhängigen Berufsschulabschluss ergänzt.
Dieser Schulabschluss ist grundsätzlich gleichwertig mit dem Hauptschulabschluss.
Mit einem Notendurchschnitt bis 3,0, der bestandenen Gesellenprüfung und ausreichenden Englischkenntnissen ist die Fachoberschulreife erreicht. Wer sich mit Abitur oder Fachhochschulreife für einen handwerklichen Beruf entscheidet, kann dies durch einen ‚Ausbildungsorientierten Studiengang‘. Diese Möglichkeit kombiniert die klassische Ausbildung in einem Handwerksbetrieb mit dem Studium an einer Fachhochschule, meist in der Fachrichtung Ingenieurwissenschaften, Informatik oder Wirtschaftsinformatik.
Den Abschluss bildet nach vier bis fünf Jahren das Hochschuldiplom in Verbindung mit dem Abschluss in einem anerkannten Ausbildungsberuf.
Wer sich für die klassische Ausbildung zum Gesellen entschieden hat kann anschließend die Weiterbildung zum Meister seines Berufes anstreben. Nach der Änderung der Handwerksordnung 2003 wird zwischen zulassungspflichtigen und zulassungsfreien Handwerken (freiwillige Meisterprüfung) unterschieden. Die Meisterbschlüsse sind jedoch gleichwertig.
Die eher traditionellen Berufsbilder des Handwerks entwickeln sich stetig und gehen mit der Zeit. Durch die andauernde Anpassung entstehen immer wieder zeitgemäße Ausbildungswege und neue Herausforderungen. So behält dieses Berufsfeld trotz der immer weiter fortschreitender Technisierung seine Daseinsberechtigung.
Gilde & Zunft
Gilde und Zunft sind Vereinigungen mit ihrem Ursprung im Mittelalter, zu der Zeit, als zahlreiche neue Städte gegründet wurden und sich dort die Handwerkszweige immer mehr spezialisierten. Die Gilde war ursprünglich eine durch einen Schwur besiegelte Vereinigung von Kaufleuten (Patrizier). Sie diente dem Schutz und der Förderung von gemeinsamen Interessen und hatte beispielsweise die Sicherheit bei Transporten und die gegenseitige Unterstützung bei Unglücksfällen zum Ziel.
Nach dem gleichen Prinzip gab es neben den Händler- und Handwerksgilden auch Söldner und Kriegergilden, die für einen begrenzten Zeitraum ihren Schutz anboten. Mitte des 14. Jahrhunderts entwickelte sich die Fernhandelsgilde, bekannt als Hanse, zu einem mächtigen Städtebund in Europa.
Die Vereinigung der Handwerker war die Zunft, die ihre Traditionen bis ins 19. Jahrhundert pflegte. Die Zünfte stellten die Regeln für das entsprechende Handwerk auf und überwachten deren Einhaltung. Schon damals wurden Ausbildung, Arbeitszeit und Qualität reglementiert. Weiterhin nahmen die Zünfte auch militärische, soziale und religiöse Aufgaben wahr.
Für die Handwerker im Mittelalter war für die Ausübung Ihres Berufes Pflicht, einer Zunft anzugehören. Von 1149 stammt die älteste urkundlich belegte Zunft – die der Kölner Bettdeckenweber. Stark eingeschränkt wurde der Zunftzwang nach der französischen Revolution. Durch diverse Befreiungskriege setzte sich um 1871 die Gewerbefreiheit durch. In Preußen wurde die Gewerbefreiheit genau am 2.11.1810 eingeführt.
Doch egal ob Gilde oder Zunft – die damals gegründeten Vereinigungen haben auch heute noch Bestand. Der Zusammenschluss von Kaufleuten und Handwerkern hat sich gemeinsam mit den unterschiedlichsten Berufsbildern und Ansprüchen gewandelt in die heutige ‚Industrie- und Handelskammer‘ und in die ‚Handwerkskammer‘.
Handwerkskammer
Handwerkskammern sind Körperschaften des öffentlichen Rechts. Selbständige Handwerksunternehmen, unterschieden in zulassungspflichtige und zulassungsfreie Handwerke, unterliegen einer Zwangsmitgliedschaft. Auch Handwerker eines handwerksähnlichen Betriebes, Gesellen, Arbeitnehmer in diesen Bereichen und Auszubildende gehören den Kammern an.
Das Verzeichnis aller Inhaber eines zulassungspflichtigen Betriebes im Zuständigkeitsbereich der jeweiligen Handwerkskammer ist die Handwerksrolle.
Die einzelnen Kammern sind in Kammerbezirke eingeteilt, die oft einem Regierungsbezirk entsprechen. Sie übernehmen unter anderem die Aufgaben der Wirtschaftsinteressen des Handwerks, die Belange der Ausbildung sowie Fördermaßnahmen.
Die Kammern dienen dem Zweck, die Interessen des Handwerks im Zuge der Selbstverwaltung zu regeln und üben die Rechtsaufsicht über Kreishandwerkschaften und die Innungen im jeweiligen Kammerbezirk aus. Die Aufgaben sind in der Handwerksordnung (HwO) festgelegt.
Mit dem Handwerkergesetz von 1897 wurden in Deutschland die Handwerkskammern gegründet und von April 1900 an entstanden 71 Handwerkskammern im Deutschen Reich. Aktuell bilden 53 Handwerkskammern den Deutschen Handwerkskammertag (DHKT) mit Sitz in Berlin, der die gemeinsamen Angelegenheiten der Handwerkskammern vertritt. Er ist der Fachübergreifende Interessenverband des deutschen Handwerks mit rund 960.000 in die Handwerksrolle eingetragenen Betrieben.
Dieser Artikel basiert auf dem Artikel Handwerkskammer aus der freien Enzyklopädie Wikipedia.
Der Text ist unter der Lizenz „Creative Commons Attribution/Share Alike“ verfügbar; zusätzliche Bedingungen können anwendbar sein. Einzelheiten sind in den Nutzungsbedingungen beschrieben. In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren verfügbar.
Schwarzarbeit
Wer Leistungen gegen Lohn erbringt, ohne die Einhaltung der gesetzlichen Arbeitsbestimmungen wie z.B. Steuer, Sozialversicherung oder Versicherungspflicht, leistet ‚Schwarzarbeit‘. Der Begriff bezeichnet somit illegale Arbeit, die weder von Arbeitgeber noch von Arbeitnehmer behördlich angemeldet ist. Schwarzarbeit kommt ursprünglich aus dem Handwerk, hat sich aber inzwischen als fester Begriff in allen Bereiche etabliert. Bei der Leistung von Schwarzarbeit werden mündliche Absprachen getroffen und die Entlohnung erfolgt bar.
Als Schwarzarbeiter findet man häufig ausländische Mitarbeiter, die gegen geringeren Lohn, nicht angemeldet, meist im Bauhandwerk tätig sind. Als zweiter Markt hat sich der Dienstleistungsbereich eröffnet. Der erhöhte Pflegebedarf ermöglicht hier ein breites Feld für nicht angemeldete Dienstleistungen. Dies reicht von regelmäßigen Hilfeleistungen bis hin zur Vollzeitpflege.
Um die Schwarzarbeit zu verhindern und dagegen vorgehen zu können gibt es das Gesetz zur Bekämpfung der Schwarzarbeit und illegalen Beschäftigung „SchwarzArbG“ . Dort ist der Begriff wir folgt definiert: „Ausübung von Dienst- oder Werkleistungen unter Verstoß gegen Steuerrecht und Sozialversicherungsrecht, unter Umgehung der Mitteilungspflicht gegenüber der Bundesagentur für Arbeit, Trägern der Grundsicherung, Sozialämtern oder ohne Gewerbeanmeldung bzw. Eintragung in die Handwerksrolle, obwohl ein Gewerbe/Handwerk ausgeübt wird." Der Verstoß gegen dieses Gesetz kann sowohl strafrechtliche als auch zivilrechtliche Folgen haben.
Die Bekämpfung der Schwarzarbeit obliegt der Bundeszollverwaltung. Diese wird jedoch verschiedenen Zusammenarbeitsbehörden unterstützt. Dies können Gemeindeverwaltungen oder Arbeitsagenturen sein. |
