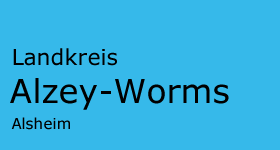Alsheim
 Herzlich willkommen auf der Seite über
Alsheim. Die Gemeinde erstreckt sich über eine Fläche von
15,54 km² Quadratkilometern. Die Einwohnerzahl von
Alsheim liegt momentan
bei ungefähr 2.910 (31. Dez. 2022) womit die durchschnittliche Einwohnerzahl pro Kilometer bei
187liegt. Hier gilt das Autokennzeichen AZ. Zu erreichen ist
die Gemeinde auch über die Domain www.alsheim.de.
Auf dieser Seite über Alsheim finden Sie nicht nur geschichtliche Informationen oder die Chronik von
Alsheim, sondern auch die von uns empfohlenen Unternehmen aus der
umliegenden Region. Herzlich willkommen auf der Seite über
Alsheim. Die Gemeinde erstreckt sich über eine Fläche von
15,54 km² Quadratkilometern. Die Einwohnerzahl von
Alsheim liegt momentan
bei ungefähr 2.910 (31. Dez. 2022) womit die durchschnittliche Einwohnerzahl pro Kilometer bei
187liegt. Hier gilt das Autokennzeichen AZ. Zu erreichen ist
die Gemeinde auch über die Domain www.alsheim.de.
Auf dieser Seite über Alsheim finden Sie nicht nur geschichtliche Informationen oder die Chronik von
Alsheim, sondern auch die von uns empfohlenen Unternehmen aus der
umliegenden Region.
Weitere Informationen finden Sie auch über
www.alsheim.de. Erreichen können Sie Alsheim über gängige Verkehrswege. Der Gemeindeschlüssel lautet
07 3 31 002.
Die Gemeinde Alsheim liegt auf einer Höhe von 89 Metern über dem
Meeresspiegel.
Suchen Sie eine Arbeitsstelle, planen eine Umschulung oder einen Berufswechsel? In unserem Stellenmarkt finden auch Sie die passenden Stellenangebote (Stellenmarkt
Alsheim).


Auch für Sparfüchse empfehlen wir Ihnen Unternehmen und Angebote aus dem ganzen Landkreis und auch
Alsheim (Sonderangebote Alsheim).
Alsheim ist eine Ortsgemeinde in Rheinhessen im Landkreis
Alzey-Worms in Rheinland-Pfalz. Sie gehört der
Verbandsgemeinde Eich an.
Geographie
Das Dorf mit dem Weiler Hangen-Wahlheim liegt inmitten von
Weinbergen am Fuß der rheinhessischen Rheinterrassen zwischen
Mainz und Worms. Durch seine Lage zwischen Rhein-Main-Gebiet
und Rhein-Neckar-Raum hat sich Alsheim zu einer Wohn- und
Pendlergemeinde entwickelt. Neue Baugebiete werden diesen
Trend weiter verstärken. Wanderwege und ein Weinlehrpfad mit
Blick in die Rheinebene erschließen zusammen mit Radwegen die
Landschaft.


Nachbargemeinden sind im Norden
Guntersblum, im Osten Gimbsheim, im Süden Mettenheim und im
Westen Dorn-Dürkheim, Wintersheim und zu einem kleinen Teil
Dittelsheim-Heßloch.
Geschichte
Die älteste erhaltene Erwähnung von Alsheim stammt von
761, als es in einer Urkunde des Klosters Lorsch als
Alahesheim genannt wird. Der Name kann „Heim des Alah“
bedeuten oder mit althochdeutsch Alah „geschützter Ort,
Einfriedung, Heiligtum, Tempel“ erklärt werden.


Der Ort war
wohl schon früher besiedelt, bei Ausgrabungen im Hahlweg fand
man unter anderem eine angelsächsische Münze aus dem 7.
Jahrhundert mit der Bezeichnung „HALASEMIA“ – wohl die
latinisierte Form von Alahesheim. Es gab offenbar schon im
siebten Jahrhundert in Alsheim eine Münzprägestätte, was auf
einen prosperierenden und länger bestehenden Ort hinweist.
Münzprägestätten hatten in der Zeit nur Städte wie Mainz,
Trier und Worms. Mit der Münze ist Alsheim die am frühesten
schriftlich benannte ländliche Siedlung in Rheinhessen.
Auf dem Gebiet des
heutigen Alsheim bestanden zwei frühmittelalterliche
Königshöfe, die im Laufe des 12. bis 13. Jahrhunderts
zusammenwuchsen. Die beiden Kirchen im Ort stammen aus der
Zeit vor der Reformation.

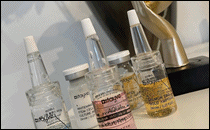
Die Alsheimer waren im
Mittelalter sehr unterschiedlichen Herrschaften zugeordnet.
Die Patronatsinhaber der Kirchen waren das Bistum Worms und
das Erzbistum Mainz, die Ortsherrschaft und die Ausübung des
Gerichts lag bei den Grafen von Leiningen. Auch das Kloster
Otterberg war im Ort begütert. 1467 erwarb Pfalzgraf Friedrich
I. von den Leiningern die Hälfte der Herrschaft, von 1532 bis
ins 18. Jahrhundert erlangte die Kurpfalz die
Landesherrschaft. Alsheim war Teil des zum kurpfälzischen
Oberamt Alzey. 1797 geriet Alsheim unter französische
Verwaltung. Während der sogenannten Franzosenzeit war der Ort
Sitz einer Mairie im Kanton Bechtheim, der Teil des
Departements Donnersberg war. Zur Mairie Alsheim gehörte auch
Hangenwahlheim. Aufgrund der 1815 auf dem Wiener Kongress
getroffenen Vereinbarungen und einem 1816 zwischen
Hessen-Darmstadt, Österreich und Preußen geschlossenen
Staatsvertrag kam die Region und damit auch die Gemeinde
Alsheim zum Großherzogtum Hessen und wurde von diesem der
Provinz Rheinhessen zugeordnet. Nach der Auflösung der
rheinhessischen Kantone kam der Ort 1835 zum neu errichteten
Kreis Worms, zu dem er bis 1969 gehörte. Nach dem Zweiten
Weltkrieg gehörte Alsheim zur französischen Besatzungszone und
wurde so 1946 zum Teil von Rheinland-Pfalz.
Wappen
Auf dem Alsheimer Wappen befinden sich
zwei gekreuzte goldene Bischofsstäbe mit weißem Pannisellus
auf rotem Grund.
Gemeindepartnerschaften
Französische Partnergemeinde: Pesmes
Deutsche Partnergemeinde: Nossen
Kultur und Sehenswürdigkeiten
Hohlwegeparadies
Das Hohlwegeparadies Alsheim
ist ein 31 km langes Wanderwegesystem in einem von
Deutschlands größten Lösshohlweggebieten. Das Motto der
Hohlwege ist „WEIN. WIND. STILLE“. Die zehn Wanderwege, die
teilweise mit Informationstafeln zu Flora und Fauna versehen
sind, führen durch verschiedene Hohlwege (insgesamt 11,5 km)
und die Alsheimer Weinberge. Die Hohlwege sind im Löss der
Rheinterrasse durch Befahren mit Pferdefuhrwerken und
landwirtschaftlichen Fahrzeugen entstanden. Die innere
Struktur des Lösses, die durch Sonneneinstrahlung
„zementartige“ Strukturen ausbildet, wird durch die Wagenräder
zerstört und kommt ins Rutschen. Es bleiben links und rechts
Lösswände, die bei ausreichender Sonneneinstrahlung sehr hart
werden bei zu starker Abdeckung durch Pflanzen instabil ist.
Die Hohlwege, die nach § 30 Bundesnaturschutzgesetz als
Biotope geschützt sind, bilden ökologisch wertvolle
Lebensräume für viele auf der Rote Liste geführte Pflanzen und
Tiere. Hierzu zählen beispielsweise die Steppenkirsche (Prunus
fruticosa) oder der Elsässer Haarstrang (Peucedanum
alsaticum), viele Wildbienenarten und der Ameisenlöwe.
Wichtige Wegbereiter des Hohlwegeparadieses waren Helmut
Storf, Gerhard Kissel und Hans-Günter Kissinger.
Es
werden regelmäßig Führungen durch das Hohlwegeparadies
angeboten.
Eine von europaweit vier Heidenturmkirchen
findet sich in Alsheim. Die evangelische Pfarrkirche St.
Bonifatius in Alsheim wurde um 1200 als romanischer Saalbau
erbaut und im 18. Jahrhundert barock überformt. Der Name
Heidenturmkirche stammt von dem Westturm, der orientalisch
anmutet. Seine Architektur führt zurück in die Zeit der
Kreuzfahrer. Weitere Heidenturmkirchen sind St. Paul in Worms,
St. Viktor in Guntersblum und Allerheiligen in
Dittelsheim-Heßloch.
Die Alsheimer
St.-Bonifatius-Kirche ist von einem parkähnlichen
Friedhofsgelände mit altem Baumbestand umgeben, dessen
Grabsteine bis ins 19. Jahrhundert zurückführen. Er gilt als
einer der verwunschesten Friedhöfe in Rheinhessen.
Barockes
Rathaus und Windbeidel
Das Alsheimer Rathaus wurde 1739
fertiggestellt, nachdem das Vorgängergebäude 1721 für
baufällig erklärt und abgerissen wurde. Die Finanzierung des
Barockgebäudes mit Krüppelwalmdach und Dachreiter (Turm mit
Uhr) erfolgte durch den Verleih der Gemeindeweide. Das Gebäude
ist unterteilt in ein Obergeschoss in Fachwerkbauart und ein
Untergeschoss, welches aus massivem Sandstein besteht und
verputzt ist. Über der Eingangstür befindet sich das Alsheimer
Wappen. Es enthält zwei gekreuzte Bischofsstäbe mit silbernen
Sudarien, welche Amts- und Würdezeichen der früheren
Patronatsinhaber Mainz und Worms repräsentieren. Das Wappen
ist wahrscheinlich aus einem Gerichtssiegel von 1501
entnommen. Aufgrund der eingravierten Jahreszahl „1606 geht
man davon aus, dass es aus dem Vorgängergebäude herausgenommen
und im Neubau wieder eingefügt wurde. Nach seiner
Fertigstellung diente das Gebäude der Ortsverwaltung, aber
auch als Gericht.
Der Alsheimer Windbeidel
(Windbeutel), der regionale Duzname der Alsheimer, steht auf
dem Rathausplatz gegenüber dem Rathaus. Er stammt von dem
Bildhauer Christoph Kappesser. Mit dem Windbeidel wird weniger
auf das schweizerische Gebäck als eher auf den Begriff der
Windbeutelei angespielt.
Jüdischer Friedhof,
Zeugnisse des jüdischen Lebens in Alsheim
Der
1896 angelegte jüdische Friedhof war eine Einrichtung der
Alsheimer jüdischen Gemeinde. Auf dem Alsheimer Friedhof sind
auch Juden aus Mettenheim und Gimbsheim verstorbenen jüdischen
Personen ihre letzte Ruhestätte. Die Friedhofsfläche umfasst
6,38 ar.
Von 1529 bis 1940 lebte eine wechselnde Zahl Alsheimer
jüdischen Bekenntnisses im Ort. 1550 wurden vier, 1722 drei,
1743 sechs, 1799 zwei jüdische Familien in Alsheim gezählt. Im
19. Jahrhundert entwickelte sich die Zahl der jüdischen
Einwohner wie folgt: 1807 14 jüdische Einwohner, 1828 38, 1861
73, 1871 79, 1895 53, 1900 43, 1910 36.
Zur Bildung
einer Kultusgemeinde kam es Mitte des 18. Jahrhunderts. Sie
schloss bis 1875 jüdische Gimbsheimer und Mettenheimer ein.
Die jüdische Gemeinde war dem Rabbinatsbezirk Worms zugeteilt.
An Einrichtungen unterhielt die jüdische Gemeinde eine
Synagoge, eine Religionsschule (seit 1873 Israelitische
Volksschule, die 1881 von 18 Kindern besucht wurde, darunter
auch zwei christlichen Kindern), ein rituelles Bad und eben
einen Friedhof. Zur Besorgung religiöser Aufgaben der Gemeinde
war ein Lehrer angestellt, der zugleich als Vorbeter und
Schochet fungierte. Prägend für das jüdische Gemeindeleben war
in der gesamten zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts Lehrer und
Vorbeter Karl Marx (1824–1910). Er war mit einem vierstimmiger
Synagogenchor weit über Alsheim hinaus bekannt. Marx spielte
auch im Leben des gesamten Dorfes Alsheim über Jahrzehnte eine
große Rolle: er hatte u. a. den "Sängerbund" gegründet (heute
MGV Eintracht Alsheim) und war jahrzehntelang dessen Dirigent.
In verschiedenen überregionalen Lehrervereinen war er im
Vorstand (u. a. Ausschussmitglied des Allgemeinen Deutschen
Lehrervereins Berlin).
Im Ersten Weltkrieg fielen aus
der jüdischen Gemeinde: Theodor Gabriel (geb. 13. Juni 1883 in
Alsheim, vor 1914 in Gelnhausen wohnhaft, gef. 26. November
1917), Max Lutzki (geb. 4. September 1893 in Alsheim, vor 1914
in Würzburg wohnhaft, gef. 30. Juni 1915).
Um 1924
waren in der 25-Mitglieder starken Gemeinde die Vorsteher
Jakob Otto David, Salomon Mayer und Eduard David. An jüdischen
Vereinen waren damals noch aktiv: der Wohltätigkeitsverein
(1924 unter Leitung von Alfred David mit acht Mitgliedern) und
der Frauenwohltätigkeitsverein (1924 unter Leitung von Frau
Isidor David mit neun Mitgliedern).
1933 wurden 35
jüdische Einwohner gezählt (drei Familien David, eine Familie
Gabriel und je eine Familie Mayer, Oppenheimer, Schlösser,
sowie der angesehene Arzt Dr. Wolff). Nach 1933 ist ein Teil
der jüdischen Gemeindeglieder auf Grund der Folgen des
wirtschaftlichen Boykotts, der zunehmenden Entrechtung und der
Repressalien weggezogen beziehungsweise ausgewandert. Von den
in Alsheim geborenen und/oder längere Zeit am Ort wohnhaften
jüdischen Personen sind in der NS-Zeit umgekommen (Angaben
nach den Listen von Yad Vashem, Jerusalem und den Angaben des
"Gedenkbuches – Opfer der Verfolgung der Juden unter der
nationalsozialistischen Gewaltherrschaft in Deutschland
1933-1945"): Jakob Otto David (1882), Johanna David geb.
Sternberg (1873), Karoline Löb geb. Reiss (1862), Albert Mayer
(1865), Moritz (Moses) Mayer (1884), Franziska Müller geb.
Oppenheimer (1867), Albert Reiss (1874), Ida Schwab (1886),
Regina (Recha) Vogel geb. Mayer (1884), Amalie Wolff geb.
David (1875), Bernhard Wolff (1870), Blanka Zeilberger geb.
Lutzky (1889).
Die Synagoge ist erhalten und wird als
Wohnhaus genutzt. Auch das Schulgebäude steht noch. Die
Gebäude befinden sich in der Mittelgasse.
Pfarrkirche Mariä Himmelfahrt
Die katholische
Pfarrkirche Mariä Himmelfahrt ist eine barocke Kirche. Der
dreiseitig geschlossene, sterngewölbte Chor der Kirche in
Alsheim wurde 1517 von Velten Ritter erbaut und von Leonhard
Stromer ausgemalt. Der Saalbau datiert von 1742. Der Hochaltar
von 1763 stammt aus dem Wormser Andreasstift und ist mit einer
Muttergottes (um 1460) versehen. Die Seitenaltäre (1742)
zieren Gemälde von Konrad Seekatz. Die Orgel wurde 1764 von
Johann Ignaz Seuffert, Bürger und Orgelmacher zu Offenburg,
dem ältesten Sohn von Johann Philipp Seuffert erbaut. Auf dem
spätbarocken Hochaltar findet sich eine Traubenmadonna mit
Kind, die um 1460 entstanden ist.
Weitere Denkmale
Regelmäßige Veranstaltungen
Rheinradeln im Mai auf der alten B 9, jetzt die K 40 und die L
439, zwischen Oppenheim und Worms-Herrnsheim. In Alsheim sind
dabei einige Winzerhöfe, insbesondere an der Strecke in der
Mainzer Straße/Bachstraße/Wormser Straße, für die Radler,
Skater und Jogger geöffnet.
Alsheimer Kerb im September
Alsheimer
Weinwandern am dritten Sonntag im September: Es wird 12 km
durch die Alsheimer Weinberge gewandert, dabei wird gegessen
und getrunken und Weintrauben probiert, danach wird in
verschiedene Winzerhöfe eingekehrt.
Wirtschaft
und Infrastruktur
Alsheim ist erheblich
geprägt vom Weinbau und mit 704 Hektar bestockter Rebfläche,
davon 69,3 Prozent Weißwein- und 30,7 Prozent Rotweinsorten,
nach Worms (1.490 Hektar), Nierstein (783 Hektar), Alzey (769
Hektar) und Westhofen (764 Hektar) größte Weinbaugemeinde
Rheinhessens und eine der größten im gesamten Bundesland
Rheinland-Pfalz. Daneben befinden sich in Alsheim mehrere
Gasthöfe und Winzerhöfe.
Eine landschaftliche Besonderheit hat
Alsheim mit seinem großen System an Hohlwegen zu bieten. 11,5
km dieser durch die menschliche Nutzung über Jahrhunderte
entstandenen Wege sind in der Gemarkung Alsheim noch vorhanden
und laden zu Wanderungen und Spaziergängen ein. In den
Sommermonaten werden Hohlwegeführungen angeboten und für
Fotofreunde auch spezielle Fotoexkursionen.
Dieser Artikel basiert auf dem Artikel
Alsheim aus der freien Enzyklopädie Wikipedia.
Der Text ist unter der Lizenz „Creative Commons Attribution/Share Alike“ verfügbar; zusätzliche Bedingungen können anwendbar sein. Einzelheiten sind in den Nutzungsbedingungen beschrieben.
In der Wikipedia ist eine Liste der
Autoren verfügbar. |