Deidesheim
 Herzlich willkommen auf der Seite über
Deidesheim. Die Gemeinde erstreckt sich über eine Fläche von
26,54 km² Quadratkilometern. Die Einwohnerzahl von
Deidesheim liegt momentan
bei ungefähr 3.724 (31. Dez. 2021) womit die durchschnittliche Einwohnerzahl pro Kilometer bei
140 liegt. Hier gilt das Autokennzeichen DÜW. Zu erreichen
ist die Gemeinde auch über die Domain www.deidesheim.de.
Auf dieser Seite über Deidesheim finden Sie nicht nur geschichtliche Informationen oder die Chronik von
Deidesheim, sondern auch die von uns empfohlenen Unternehmen aus der
umliegenden Region. Herzlich willkommen auf der Seite über
Deidesheim. Die Gemeinde erstreckt sich über eine Fläche von
26,54 km² Quadratkilometern. Die Einwohnerzahl von
Deidesheim liegt momentan
bei ungefähr 3.724 (31. Dez. 2021) womit die durchschnittliche Einwohnerzahl pro Kilometer bei
140 liegt. Hier gilt das Autokennzeichen DÜW. Zu erreichen
ist die Gemeinde auch über die Domain www.deidesheim.de.
Auf dieser Seite über Deidesheim finden Sie nicht nur geschichtliche Informationen oder die Chronik von
Deidesheim, sondern auch die von uns empfohlenen Unternehmen aus der
umliegenden Region.
Weitere Informationen finden Sie auch über
www.deidesheim.de. Erreichen können Sie Deidesheim über gängige Verkehrswege. Der Gemeindeschlüssel lautet
07 3 32 009.
Die Gemeinde Deidesheim liegt auf einer Höhe von
120 Metern über dem
Meeresspiegel.


Suchen Sie eine Arbeitsstelle, planen eine Umschulung oder einen Berufswechsel? In unserem Stellenmarkt finden auch Sie die passenden Stellenangebote (Stellenmarkt
Deidesheim).
Auch für Sparfüchse empfehlen wir Ihnen Unternehmen und Angebote aus dem ganzen Landkreis und auch
Deidesheim (Sonderangebote Deidesheim).
Deidesheim ist eine Landstadt und ein Luftkurort mit 3724
Einwohnern (31. Dezember 2021), die im rheinland-pfälzischen
Landkreis Bad Dürkheim im Nordwesten der Metropolregion
Rhein-Neckar liegt. Seit dem 1. Januar 1973 gehört die Stadt
der Verbandsgemeinde Deidesheim an, deren Verwaltungssitz sie
auch ist.


Der Ort entstand vermutlich im 9. oder 10.
Jahrhundert als Tochtersiedlung der Nachbargemeinde
Niederkirchen, und mit dem Bau der
fürstbischöflich-speyerischen Burg als Amtssitz übertraf
Deidesheim das ältere Niederkirchen bald an Bedeutung. Im Jahr
1395 bekam Deidesheim vom böhmischen und deutschen König
Wenzel die Stadtrechte verliehen und gilt seither – mit
Ausnahme der Jahre 1819 bis 1838 – als Stadt.
Seit 770
wird hier nachweislich Weinbau betrieben. Zu Anfang des 19.
Jahrhunderts war Deidesheim der erste Ort der Pfalz, dessen
Weingüter damit begannen, Qualitätsweinbau zu betreiben. Heute
ist Deidesheim eine der größten Weinbaugemeinden des
Weinbaugebiets Pfalz, der Weinbau ist neben dem Tourismus sein
wichtigster Wirtschaftsfaktor.

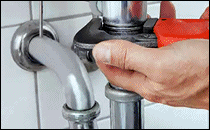
Lage
Deidesheim
liegt in der Pfalz im Bereich der Region Weinstraße, etwa
einen halben Kilometer östlich der Haardt, auf einer Höhe von
120 m ü. NHN. Der Ort befindet sich im Nordwesten der
Metropolregion Rhein-Neckar inmitten des Weinbaugebiets der
Pfalz und wird von der Deutschen Weinstraße durchzogen.
Flächenaufteilung
Das 2654 ha große Areal des zur
Stadt gehörenden Gebietes erstreckt sich über die drei
morphologischen und landschaftsökologischen Einheiten
Pfälzerwald, Hügelzone der Region Weinstraße und
Rheinniederung.



Mit 1784 ha bedeckt Wald den größten
Teil der Gemarkung. Deidesheim, zu dem bis 1819 das
benachbarte Niederkirchen dazuzählte, besaß ursprünglich eine
Waldfläche mit einer Ausdehnung von etwa 12000 Morgen (circa
3000 ha). Das Areal wurde im Osten vom Haardtrand – von
Forst-Deidesheim bis Gimmeldingen-Neustadter Tal reichend –,
im Süden vom Hambacher Geraidewald, im Westen von der
Frankenweide und im Norden vom Wachenheimer Wald begrenzt. Es
umfasste auch die Gemarkungen der Gemeinden Lambrecht und
Lindenberg.
Auf den landwirtschaftlich genutzten
Flächen, die mit 626 ha den zweitgrößten Teil der Gemarkung
bedecken, sind zum einen Weinberge, die vor allem westlich und
nördlich der Stadt in der Vorhügelzone vor der Haardt liegen,
teilweise aber auch bis in die Ebene hineinreichen. Östlich
der Stadt befinden sich vor allem Wiesen.
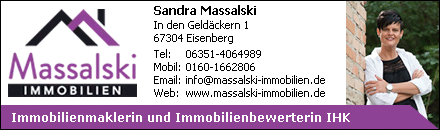

Erhebungen
Die höchsten Erhebungen sind Berge des Pfälzerwaldes
im Westen der Gemarkung: Der Hohe Stoppelkopf (566 m), der
Teil der Wasserscheide zwischen den Einzugsgebieten des
Speyerbachs (südlich) und der Isenach (nördlich) ist, der
Vordere Langenberg (545 m), der Hermannskopf (530 m) und der
Eckkopf (516 m) mit dem Eckkopfturm. Näher am Ort, am Ostkamm
der Haardt, befinden sich der Rehberg (337 m), der Waldberg
(343 m) mit dem Turnerehrenmal und der Kirchberg (344 m); auf
seiner Kuppe befinden sich die Heidenlöcher und auf seinem
Hang die Michaelskapelle. Im äußersten Südwesten der Gemarkung
an der Grenze zu Lambrecht erstrecken sich der Eichelberg und
der Kreuzberg.

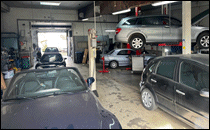
Gewässer
Am
südöstlichen Rand des Siedlungsgebiets entspringt die in
West-Ost-Richtung verlaufende Marlach. Sie mündet östlich von
Dannstadt-Schauernheim in den Floßbach. Seinen Ursprung im
Martental des Pfälzerwaldes – auf der Gemarkung Deidesheims –
hat der Weinbach, dessen Quelle, die Weinbachspring, gefasst
ist. Der Weinbach nimmt etwa 400 m östlich seiner Quelle
Wasser vom Grimmeisenbrunnen auf. Er fließt in
West-Ost-Richtung durch die Bebauung und mündet östlich von
Niederkirchen bei Deidesheim in die Marlach. Östlich von
Deidesheim hat zudem der Alte Weinbach seinen Ursprung; der
östlich des Eckkopfs entspringende Moosbach ist ein Zufluss zu
diesem.


Der Mußbach, der auf der Waldgemarkung von
Wachenheim an der Weinstraße entspringt, fließt ein Stück
durch Deidesheimer Gemarkung; er nimmt in diesem Bereich von
links den 700 m langen Bach vom Schnokebrunnen auf. Er
durchquert das Benjental und an Grenze zu Neustadt an der
Weinstraße passiert er das Alte Jagdhaus Looganlage. Östlich
des gleichnamigen Ortes Mußbach mündet er in den Rehbach. Im
äußersten Westen der Gemarkung entspringen der zunächst nach
Osten fließende Schlangentalbach, der kurz nach einer Änderung
der Fließrichtung nach Süden die Grenze zu Lindenberg
überschreitet und dort von links in den Speyerbach mündet,
sowie der in Nord-Süd-Richtung fließende Luhrbach, der in der
Stadtmitte von Lambrecht ebenfalls in den Speyerbach mündet.
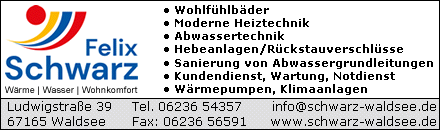

Klima
Makroklimatisch wird Deidesheim
vom Relief der Umgegend mitgeprägt: Die Regengebiete, die von
Westen und Südwesten heranziehen, müssen wegen des westlich
vorgelagerten Pfälzerwaldes aufsteigen und sich dabei
abregnen. Danach fällt die trocken gewordene Luft östlich des
Pfälzerwaldes wieder herab, wo sie sich erwärmen kann.
Aufgrund dessen ist im Lee des Pfälzerwaldes die
Niederschlagsmenge recht gering, die Sonnenscheindauer dagegen
relativ hoch. Die Zahl der Sommertage übersteigt mit 40 bis 50
den Bundesdurchschnitt deutlich.
Lokalklimatisch
gesehen ist die Stadt Teil der klimatisch begünstigten
Vorhügelzone der Weinstraße. Mit einer mittleren Höhenlage von
235 m ü. NHN am Waldrand reicht das Gelände der Deidesheimer
Umgegend bis etwa 130 m ü. NHN zum unteren Mittelhangsbereich
der Vorhügelzone herab. Die Ausläufer des Martentals und des
Sensentals, sowie nordwestlich von Deidesheim des Einsteltals
bilden Abflussbahnen für die von der Haardt kommenden
Kaltluftströme. Daneben haben kleine Mulden und Dellen, in
denen sich Kaltluft sammeln kann, lokalklimatische Wirkung.
Die klimatischen Verhältnisse in Deidesheim haben beinahe
mediterrane Züge, was sich durch das Reifen von Feigen,
Mandeln und Bitterorangen in der Gegend zeigt; davon
profitieren insbesondere wärmeliebende Kulturpflanzen wie die
Weinrebe. Dies begünstigt den hier in großem Stil betriebenen
Weinbau: Durch die lange Vegetationsperiode kann der Wein voll
ausreifen, und Frostschäden sind selten. Hier ausgebaute Weine
können eine hohe Qualität erreichen.
Die mittlere
Jahrestemperatur beträgt 10,9 °C; im Juli beträgt die mittlere
Temperatur 20,1 °C, im Januar 1,9 °C.[10] Die höchsten
Temperaturen und die meisten Niederschläge gibt es in den
Sommermonaten, wobei die Niederschläge oft bei Gewittern
niedergehen und lange trockene Phasen im Sommer nicht selten
sind.
Geologie
Ein bedeutendes Ereignis
in der Landschaftsentwicklung bei Deidesheim und der ganzen
Vorderpfalz war der Einbruch des Oberrheingrabens gegenüber
der Haardt, der im Alttertiär vor etwa 65 Mio. Jahren
einsetzte und bis heute andauert. Während der Eiszeiten kam es
zu allmählichen Abgleitbewegungen der Hänge und zur
Abschleifung durch den Wind; ferner wurde die Fläche vor dem
Haardtgebirge von Bächen zerschnitten, die im Pfälzerwald
entspringen. Diese Umformungen des ursprünglichen
Oberflächenreliefs resultierten in der Ausbildung einer
Schwemmfächerebene mit Aufschüttungs- und
Abtragungsterrassen. In trockenkalten Phasen bildeten sich in
der Umgebung durch Windeinflüsse Lössschichten: Die
vorherrschenden Ostwinde wehten kalkhaltigen Sand und Staub
aus dem Rhein, der damals häufig kein Wasser führte. Die Winde
wurde von der Gebirgsmauer der Haardt abgebremst, so dass sich
Löss hier an Verwerfungen sowie im Lee von Kleinmulden
ansammelte; bei Deidesheim sind diese Ablagerungen bis zu acht
Meter hoch.
Beim Geotop „Rheingrabenrandstörung am
Hahnenbühl“ nordwestlich der Stadt kann man anhand der
Anordnung der Gesteinsschichten das Absinken des
Oberrheingrabens gut erkennen. Er wurde in die Liste der
Nationalen Geotope aufgenommen.
Westlich und
nordwestlich von Deidesheim stellt der im mittleren
Pfälzerwald vorherrschende Voltziensandstein aus der Trias
neben den sogenannten Rehberg-Schichten die älteste
stratigraphische Einheit auf der Gemarkung dar. Im Südwesten
der Stadt sind pleistozäne Ablagerungen zu finden; sie
entstanden vor etwa 1,5 Mio. Jahren. Im Norden ist sie von
einem Band pliozäner Ablagerungen umgeben, die sich vor etwa 3
Mio. Jahren gebildet haben. Im Osten finden sich mit holozänen
Ablagerungen die jüngsten stratigraphischen Einheiten. Mit
Fremdmaterial wie Basalt, Ziegeln und Stallmist hat der Mensch
den natürlichen Aufbau der Böden verändert. Die wichtigsten
Bodentypen bei Deidesheim sind unterschiedliche Rigosole,
Rendzina, Parabraunerde und kalkhaltige Terra-fusca.
Ortsname
Die frühesten Erwähnungen des
Ortsnamens sind in Urkunden des Klosters Weißenburg (699)
sowie des Klosters Fulda (770) und des Klosters Lorsch (770/71
bis um 800) zu finden. Sie bezogen sich auf das benachbarte
Niederkirchen bei Deidesheim, die Muttergemeinde
Deidesheims. Man geht heute davon aus, dass der Ortsname aus
fränkischer Zeit stammt. In der Gegend um Deidesheim gab es
zahlreiche fränkische Ortsgründungen, welche heute die Endung
„-heim“ aufweisen. Der Ortsname bezieht sich möglicherweise
auf „Theodin“, der Niederkirchen gegründet haben soll. Der
Name „Didinnischaime“ aus der Urkunde von 699 steht dieser
Erklärung zufolge für „Heim des Theodin“ (=Dîdîn).
Die erste nachweisliche
Unterscheidung zwischen „Niederdeidesheim“, dem heutigen
Niederkirchen, und „Oberdeidesheim“, dem heutigen Deidesheim,
gab es erst im 13. und 14. Jahrhundert. Nachdem zu Anfang des
14. Jahrhunderts eine Kirche in Deidesheim errichtet worden
war, nannte man die Kirche der Muttergemeinde „Untere Kirche“
oder „Niedere Kirche“, während das Deidesheimer Gotteshaus als
„Obere Kirche“ bezeichnet wurde. Auf diese Weise entstand der
Name „Niederkirchen“ für die Muttergemeinde, und der Name
„Deidesheim“ war zum Ende des Mittelalters von Niederkirchen
auf die Tochtergemeinde, das heutige Deidesheim, übergegangen.
Im örtlichen Dialekt – auf Pfälzisch – heißt die Stadt
„Deisem“.
Mittelalter und frühe Neuzeit
Entstehung
Deidesheim entstand wahrscheinlich im 9. oder 10.
Jahrhundert als Tochtersiedlung neben Niederkirchen auf dessen
Gemarkung. Die einzelnen Siedlungen verselbständigten sich
mit dem Bau der fürstbischöflichen Burg in Deidesheim, auf die
es im Jahr 1292 den ersten Hinweis gab. Deidesheim
übertraf das ältere Niederkirchen aufgrund seiner günstigen
Lage an einer Straße und der Errichtung der Burg bald an
Bedeutung; eine solche Schwerpunktverlagerung infolge des Baus
einer Burg oder Befestigung ist nicht ungewöhnlich und findet
sich zum Beispiel auch bei Bad Kreuznach und Ingelheim am
Rhein.
Zugehörigkeit zum Hochstift Speyer
Deidesheim war im frühen Mittelalter im Wesentlichen im
Besitz des begüterten Erimbert, der durch eine Schenkung für
die erste urkundliche Erwähnung Deidesheims sorgte, und dessen
Sippe. In den Jahren 1057 und 1086 schenkte Heinrich IV. Teile
Deidesheims dem St. Emmeram- und dem St. Martinsaltar des
Speyerer Doms, sowie dem Stift St. Guido (Speyer). Durch
Schenkungen von Johannes I. um das Jahr 1100 kam Deidesheim
endgültig in den Besitz des Hochstifts Speyer. Die
Schenkungsurkunde ist nicht erhalten geblieben, doch in
Philipp Simonis' Werk „Historische Beschreibung aller
Bischoffen zu Speyr“ lassen sich Einzelheiten nachlesen; die
Richtigkeit dieser Angaben ist jedoch umstritten. Das Kloster
Otterberg war im Ort umfangreich begütert und unterhielt hier
einen eigenen Wirtschaftshof.
Stadtwerdung
Wie
Aufzeichnungen des Speyerer Hochstifts belegen, entwickelte
sich Deidesheim schnell zu einem wirtschaftlich bedeutenden
Ort, wozu die Niederlassung finanzkräftiger Juden beitrug, die
bis zu den Pogromen während der Pestzeit um 1349 eine eigene
Gemeinde in Deidesheim hatten. Ein Zeugnis für die Finanzkraft
der Stadt ist die Tatsache, dass sie von 1430 bis 1439 und von
1465 bis 1472 vom Speyerer Bischof verpfändet wurde, weil
dieser große Geldbeträge aufbringen musste. Seit etwa 1300 war
die Stadt zudem Sitz des Amts Deidesheim, des nordwestlichen
Teils des Hochstifts Speyer. Dieser Entwicklung entsprechend
entstand damals der Wunsch der Einwohner, dem wirtschaftlich
florierenden Ort größeren Schutz vor Angriffen zu bieten, dem
schließlich vom Speyerer Bischof Gerhard von Ehrenberg durch
die Vergabe der Befestigungsrechte im Jahr 1360 entsprochen
wurde; damals wurde mit dem Bau der Stadtbefestigung bereits
das Ziel angestrebt, Deidesheim zur Stadt zu machen, um einen
Zentralort im nördlichen Teil des Speyerer Hochstifts zu
schaffen.
Es dauerte jedoch
35 Jahre, bis Deidesheim die Stadtrechte gewährt wurden: Dies
geschah auf Initiative des Speyerer Bischofs Nikolaus von
Wiesbaden, dem am Valentinstag (14. Februar) des Jahres 1395 –
neben der Bestätigung seiner Besitzungen und Rechte in
Deidesheim – vom böhmischen und deutschen König Wenzel die für
Deidesheim erbetenen Stadtrechte förmlich verliehen wurden.
Wurde durch diese Stadtwerdung vor allem der Speyerer Bischof
begünstigt, so bewirkte diese ebenso für die Stadtbewohner
Positives: Im Unterschied zu den Dörfern der Umgegend wurde
auf deren Leibeigenschaft faktisch verzichtet; diese trat erst
bei einem Wegzug wieder in Kraft. Außerdem war das Ausmaß der
Frondienste, die zu leisten waren, beschränkt. Diese
Privilegierung galt bis in das 18. Jahrhundert hinein, als die
Einwohner des Speyerer Hochstifts rechtlich gleichgestellt
wurden.
Kriegszeiten und Folgen
Ein weiterer
Aspekt der Stadtwerdung war die Tatsache, dass die
Befestigung, welche die Stadt in Kriegszeiten zwar nur bedingt
schützen konnte, im Alltag Schutz gegen umherziehendes
Gesindel bot. In den Jahren 1396, 1460, 1525 (Deutscher
Bauernkrieg), 1552 beim Rückzug des Albrecht Alcibiades in das
Hochstift Speyer erlitt Deidesheim infolge von
Kriegshandlungen nennenswerte Schäden. Auch während des
Dreißigjährigen Krieges blieb die Stadt nicht verschont: 1621
wurde sie von protestantischen Truppen unter Peter Ernst II.
von Mansfeld eingenommen und ausgeplündert; 1631 wurde sie
wieder von protestantischen Truppen erobert, als der
Schwedenkönig Gustav II. Adolf mit seinen Truppen in der Pfalz
einfiel, und sie wurde schließlich ein weiteres Mal 1639 von
protestantischen Truppen eingenommen und geplündert. Im
Pfälzischen Erbfolgekrieg wurde Deidesheim 1689 von
französischen und 1693 von deutschen Truppen erobert, dabei
teilweise geplündert und niedergebrannt; am schlimmsten traf
es die Stadt 1689, als sie am 6. September von französischen
Truppen unter Ezéchiel de Mélac beinahe vollständig
niedergebrannt wurde und danach zu großen Teilen von Grund auf
neu aufgebaut werden musste.
Die zahlreichen Kriege
verhinderten, dass Deidesheim im Spätmittelalter eine noch
positivere Entwicklung nehmen konnte; dennoch kann die Stadt
unter allen Städtegründungen der Speyerer Bischöfe als die
erfolgreichste gesehen werden, wozu der Umstand beitrug, dass
aufgrund der Klimagunst der örtliche Wein wegen seiner
Qualität geschätzt war, weswegen viele Adlige in Deidesheim
waren, die für die Entwicklung der Stadt Impulse gaben; dazu
gehörten unter anderem die von Bach, die Leyser von Lambsheim,
die Schliederer von Lachen und die von Böhl.
Gegen Ende des Heiligen Römischen Reiches und der
Herrschaft der Speyerer Bischöfe in Deidesheim konnte die
Stadt schließlich administrativ und wirtschaftlich ein
zentraler Ort im nördlichen Teil des Speyerer Hochstifts
werden, wie es schon im 14. Jahrhundert beabsichtigt war; dies
hing jedoch damit zusammen, dass das Gebiet des Speyerer
Hochstifts seit damals etwas zusammengeschrumpft war.
Französische Revolution
Verlust der städtischen
Vorrechte
Während des 18. Jahrhunderts wuchs
die Bevölkerung stark, so dass die Stadtmauer allmählich zu
klein wurde; weil sie deswegen ihre Schutzfunktion nicht mehr
richtig erfüllen konnte und nicht in Stand gehalten wurde,
begann sie langsam zu verfallen. Ebenfalls im 18. Jahrhundert
beschnitten die Speyerer Bischöfe die städtischen Rechte der
Deidesheimer, welche diese mit der Verleihung der Stadtrechte
Ende des 14. Jahrhunderts erworben hatten, wozu der faktische
Verzicht ihrer Leibeigenschaft, das Recht auf Freizügigkeit
und die Beschränkung der Frondienste zählte. Dies führte zu
zahlreichen Beschwerden bei der bischöflichen Regierung des
Hochstifts; zum wiederholten Male – unter dem Eindruck der
revolutionären Vorgänge in Frankreich – 1789, zusammen mit
Bruchsal, das ebenfalls zum Hochstift gehörte. Der Bischof
Speyers, August von Limburg-Stirum, äußerte daraufhin
gegenüber dem römisch-deutschen Kaiser Joseph II. die
Befürchtung von revolutionären Unruhen und forderte diesen
auf, gegen revoltierende Untertanen vorzugehen. Tatsächlich
hielt Joseph II. mittels einer Nachricht, die per Eilboten
verschickt wurde, die Deidesheimer und Bruchsaler dazu an, das
Ergebnis ihrer Petition in Ruhe abzuwarten. Nach dem Tod
Josephs im Februar 1790 nutzte August von Limburg-Stirum das
entstandene Machtvakuum, um alle Forderungen abzulehnen. Erst
dessen Nachfolger, Philipp Franz Wilderich Nepomuk von
Walderdorf, der letzte Fürstbischof Speyers, befreite unter
den Vorzeichen der Auflösung des Heiligen Römischen Reiches
die Stadt 1798 schließlich von ihrer Leibeigenschaft.
Erster Koalitionskrieg
Eine schlimme Zeit
für Deidesheim begann am 20. April 1792 mit dem Beginn des
Ersten Koalitionskrieges, in dessen Verlauf das Kriegsglück im
Raum der heutigen Pfalz sehr häufig wechselte. Am 18. Februar
1793 erreichten erstmals französische Revolutionstruppen
Deidesheim; sie forderten von den Deidesheimern eine
Eidesleistung, der diese nur widerwillig nachkamen. Bereits am
2. April desselben Jahres eroberten preußische Truppen
Deidesheim zurück. Nach der Niederlage der koalierten Truppen
bei der Schlacht bei Weißenburg am 26. Dezember 1793 eroberten
französische Truppen die Stadt und das gesamte linksrheinische
Gebiet; dabei wurde Deidesheim von den lax geführten
französischen Truppen massiv ausgeplündert, was zu einer
schweren Notlage der Bevölkerung führte (in der Pfalz war vom
„Plünderwinter“ die Rede). Am 23. Mai 1794 kam es
schließlich zu einem Gefecht direkt bei Deidesheim, bei dem
sich preußische Truppen unter Wichard von Möllendorff,
Friedrich Ludwig Fürst zu Hohenlohe-Ingelfingen und Gebhard
Leberecht von Blücher und französische Truppen
gegenüberstanden und in dessen Folge die Franzosen vertrieben
wurden; einige Teile Deidesheims wurden beim Rückzug des
französischen Heeres zerstört. Nach einem neuerlichen
Großangriff der Franzosen im Juli 1794 wurden die koalierten
Truppen wieder zum Rückzug über den Rhein gezwungen und
Deidesheim war wieder in französischer Hand. 1795 wurde die
Stadt ein letztes Mal von kaiserlichen Truppen erobert, die
jedoch bald darauf wieder ins Rechtsrheinische verlegt wurden.
Der Frieden von Campo Formio (1797) regelte schließlich
formell die französische Herrschaft zwischen Bingen und
Landau; Deidesheim gehörte ab diesem Zeitpunkt bis 1814
zum Département du Mont-Tonnerre. Anfang des 19. Jahrhunderts
erholte sich die Stadt wirtschaftlich von den Schäden des
Ersten Koalitionskrieges; ihre Rolle als Zentrum der
Verwaltung, die sie vor der Revolution innehatte, war jedoch
an Dürkheim übergegangen, das Hauptort des neugebildeten
Kantons Dürkheim wurde, zu dem Deidesheim nun gehörte.
Deidesheim war während dieser Zeit Sitz einer Mairie, zu der
auch das benachbarte Niederkirchen gehörte.
19.
Jahrhundert
Vormärz
Nach dem Zusammenbruch der
napoleonischen Herrschaft 1814 besetzten koalierte Truppen den
linksrheinischen Teil Deutschlands. Zwischen 1814 und 1816
stand Deidesheim unter österreichischer und bayerischer
Verwaltung, ab dem 30. April 1816 war Deidesheim – infolge der
territorialen Neuordnung Europas auf dem Wiener Kongress – als
Teil des Rheinkreises, der ab 1838 den Namen „Kreis Pfalz“
trug, Teil des Königreichs Bayern. Im Jahr 1819 wurde
Niederkirchen, das nach dem Wiener Kongress für kurze Zeit ein
Ortsteil Deidesheims war, zur eigenständigen Gemeinde erhoben,
wodurch Deidesheim beinahe ein Drittel seiner Einwohner verlor
und von einer Stadt zu einer Gemeinde herabgestuft wurde. Erst
1838 hatte die Einwohnerzahl wieder einen Stand erreicht, der
es zuließ, dass es am 20. März 1838 den verfassungsmäßigen
Bestimmungen Bayerns gemäß wieder zur Stadt erhoben wurde.
Von 1818 bis 1862 gehörte Deidesheim dem Landkommissariat
Neustadt an; aus diesem ging das Bezirksamt Neustadt hervor.
Das ganze 19. Jahrhundert hindurch bis weit ins 20.
Jahrhundert hinein überstiegen die landwirtschaftlichen
Berufsgruppen die übrigen zahlenmäßig bei weitem; der einzige
„Industriezweig“ von Bedeutung war die Früchtekonservierung.
Vorreiter war hier Franz Peter Buhl, später kam noch die
„Deidesheimer Conservernfabrik J. Biffar & Cie“ dazu. In den
1820er-Jahren hatten die örtlichen Winzer unter einem
Preisverfall infolge der Ausdehnung des Weinbaus und unter der
Erhebung von Zöllen an innerdeutschen Grenzen zu leiden; das
bayerische Zollgesetz vom 22. Juli 1819 schrieb vor, dass
Waren beim Import vom links- ins rechtsrheinische Bayern
zollpflichtig waren. Aufgrund dessen trugen beim Hambacher
Fest im Mai 1832, bei dem auch eine Deidesheimer Delegation
dabei war, teilnehmende Winzer aus Dürkheim eine schwarze
Protestfahne mit sich. Mit der Entstehung des Deutschen
Zollvereins am 1. Januar 1834 fielen die Zollschranken um die
heutige Pfalz schließlich, was die Situation der örtlichen
Winzer dauerhaft verbesserte.
Pfälzischer Aufstand
Dem Pfälzischen Aufstand und seiner Zielsetzung standen viele
Deidesheimer zunächst positiv gegenüber; so wurden am 15. Mai
1849 von ihnen 500 Gulden in die Kasse des
Landesverteidigungsausschusses eingezahlt, Bürgermeister
Ludwig Andreas Jordan meldete dem Neustadter Bürgermeisteramt,
dass Deidesheim eine Bürgerwehr aufgestellt und der Stadtrat
beschlossen habe, mit allen Mitteln für die
Paulskirchenverfassung einzutreten. In dem sogenannten „Hohlen
Fels“ auf der Gemarkung der Stadt beim Stabenberg sollen sich
Freischärler versteckt haben. Nachdem am 17. Mai in
Kaiserslautern eine provisorische Regierung gebildet worden
war, die die Deidesheimer Beamten aufforderte, einen Eid auf
die Paulskirchenverfassung zu leisten, wurde dies von
Bürgermeister Ludwig Andreas Jordan jedoch bis zum Eintreffen
preußischer Truppen immer wieder hinausgezögert, so dass die
Stadt von späteren Sanktionen weitgehend verschont wurde.
Mehrheitlich sahen die Deidesheimer, vor allem die
Gutsbesitzer, das Streben nach der Deutschen Einheit mit
Sympathie. Am 23. Juli 1852 kam der frühere bayerische König
Ludwig I., der 1848 abgedankt hatte, in ihre Stadt. Bei diesem
Besuch erregten einige Gutsbesitzer den Zorn des
Regierungspräsidenten, weil sie schwarz-rot-goldene Flaggen
gehisst hatten, obwohl dies im Vorfeld ausdrücklich verboten
worden war.
Nach der Reichsgründung
Ab den 1850er-Jahren erlebte der Weinbau in Deidesheim eine
Blütezeit, nachdem sich erst durch den Zollverein und
anschließend die Reichseinheit ein immer freierer Wettbewerb
entfalten konnte und neue Absatzmärkte in Russland und
Nordamerika erschlossen wurden. In den letzten Jahren des 19.
Jahrhunderts jedoch änderte sich das Bild und der Weinbau
rutschte infolge von künstlicher Herstellung von Weinen, dem
Import von Billigweinen in großem Stil und dem Auftreten von
Schädlingen wie dem Sauerwurm und der Reblaus in eine tiefe
Krise, so dass der örtliche Weinbau vorübergehend rückläufig
war Dennoch blieb der Weinbau der wichtigste Wirtschaftszweig;
zur Jahrhundertwende arbeitete mehr als die Hälfte der
männlichen Bevölkerung in der Landwirtschaft, davon waren 78 %
Winzer, weitere 21 % davon arbeiteten handwerklich, etwa als
Küfer.
Am 6. Mai 1865 erhielt die Stadt
Anschluss an die Bahnstrecke Neustadt–Dürkheim und entwickelte
sich zu einem bedeutenden Umschlagplatz in der Rheinpfalz;
1890 lag sie beim Empfang von Dünger mengenmäßig noch vor
Ludwigshafen am Rhein und allen übrigen Orten mit Bahnhöfen in
der Pfalz.
1886 wurde in Deidesheim das erste
Schwimmbad der Pfalz eröffnet. Um die Jahrhundertwende hielten
einige wichtige industrielle Errungenschaften Einzug: um 1894
erhielt der Ort eine Gasanstalt, 1896 kam eine elektrische
Beleuchtung hinzu, 1897 ein örtliches Stromnetz, und 1898
wurde der Ort an eine allgemeine Wasserleitung angeschlossen.
Des Weiteren besaßen Ende des 19. Jahrhunderts alle
bedeutenden Gutshöfe einen Telefonanschluss. 1902
wechselte die Stadt in das neu geschaffene Bezirksamt
Dürkheim.
Weimarer Republik und Drittes Reich
Französische Besatzung
Die Entwicklung
Deidesheims zwischen den Weltkriegen stimmt im Wesentlichen
mit derjenigen der Pfalz überein. Nach dem Ende des Ersten
Weltkrieges 1918 rückten französische Truppen ein und es
wurden Truppenteile im Ort einquartiert – zeitweise mehr als
2500 Mann. Im August 1921 gab es einen großen Waldbrand, bei
dem etwa 300 ha Wald verbrannten, davon 130 ha des
Deidesheimer Stadtwaldes. Zur Brandbekämpfung wurden alle
männlichen Einwohner rekrutiert, die älter als 17 Jahre waren;
insgesamt wurden etwa 500 Einsatzkräfte für Löscharbeiten
aufgeboten, die später noch von 300 französischen
Besatzungskräften unterstützt wurden. Die Löscharbeiten zogen
sich drei Tage und drei Nächte lang hin.
Die
Politik der französischen Besatzung war es, die Bewohner des
Rheinlandes politisch und kulturell dem übrigen Reich zu
entfremden und den Separatismus zu befördern, der sich 1919
(Ausrufung der Pfälzischen Republik) und besonders im Jahr der
Hyperinflation 1923 (Ausrufung der Autonomen Pfalz)
niederschlug. Separatisten bildeten 1923 in der Pfalz eine
provisorische Regierung und ersuchten alle Ortsvorsteher um
formelle Anerkennung; doch unter der Führung des Deidesheimer
Bürgermeisters Arnold Siben wiesen zahlreiche Ortsvorsteher
diese Aufforderung zurück und forderten eine Volksabstimmung.
Siben erreichte, dass Deidesheim, im Unterschied zu den
meisten pfälzischen Gemeinden, nicht von Separatisten besetzt
wurde. Im Juli 1930 räumten die französischen Truppen das
Rheinland; im Zuge der anschließenden Feierlichkeiten besuchte
Reichspräsident Paul von Hindenburg das Rheinland und kam
dabei auch nach Deidesheim.[46] Ein Jahr später wurde das
Bezirksamt Dürkheim aufgelöst, womit erneut das Neustadter
Pendant für Deidesheim zuständig war.
Drittes Reich und
Zweiter Weltkrieg
Im Unterschied zur übrigen
Pfalz, die überdurchschnittlich viel zum Aufstieg der NSDAP
beitrug, wählten die Deidesheimer noch bis 1933 bei den
Reichstagswahlen die Zentrumspartei mit absoluter Mehrheit;
vor der Machtergreifung 1933 waren 17 Bewohner der Partei
beigetreten und seit 1930 gab es die von Adam Durein
gegründete Ortsgruppe der NSDAP, zu der zusätzlich Forst an
der Weinstraße, Ruppertsberg und Niederkirchen gehörten. Bei
den Pogromen vom 9. November 1938 gab es in Deidesheim keine
Zerstörungen, dennoch wurden einen Tag später die Häuser
zweier jüdischer Familien und der Jüdische Friedhof verwüstet.
Die Synagoge war bereits 1936 von der jüdischen Gemeinde
verkauft worden und deshalb der Zerstörung entgangen. Ab 1939
war Deidesheim Bestandteil des Landkreises Neustadt. Während
des Zweiten Weltkrieges blieb die Stadt von schweren
Kriegsschäden zunächst verschont. Aber am 9. März 1945, kurz
vor Kriegsende, wurde das Spital von einer Bombe getroffen;
dabei verloren acht Menschen ihr Leben. Am 21. März 1945
rückten amerikanische Verbände kampflos ein, obwohl bereits im
Herbst 1944 eine Panzersperre vorbereitet wurde, deren
Schließung jedoch von einigen Bürgern verhindert worden war.
Seit Gründung der Bundesrepublik
Bauliche
Entwicklung
1946 wurde Deidesheim innerhalb
der französischen Besatzungszone Teil des damals neu
gebildeten Landes Rheinland-Pfalz, womit die Zugehörigkeit zu
Bayern endete. Nach dem Krieg wurden einige Verbesserungen an
der Infrastruktur angegangen. So wurden die Straßenbeleuchtung
und das Schwimmbad modernisiert und eine Kanalisation
geschaffen; die Grundschule wurde 1960 neu errichtet, 1964
wurde die Stadthalle „Paradiesgarten“ gebaut, zehn Jahre
später eine Hauptschule. Die Bevölkerungszahl überstieg die
3000er-Marke; weil sich Deidesheim nicht weiter nach Westen
ausdehnen konnte, ohne für die Bebauung beste Weinlagen zu
opfern, wurde 1978 ein neuer Flächennutzungsplan beschlossen,
der die bauliche Entwicklung Richtung Osten lenkte, so dass
der Ort sich fortan vor allem östlich der Bahnstrecke
Neustadt–Dürkheim ausdehnte. Im Zuge der ersten
rheinland-pfälzischen Verwaltungsreform wechselte die Stadt
1969 zusammen mit den meisten Orten des zeitgleich aufgelösten
Landkreises Neustadt in den neu geschaffenen Landkreis Bad
Dürkheim. Mit Forst an der Weinstraße, Ruppertsberg,
Niederkirchen bei Deidesheim und Meckenheim (Pfalz) bildet
Deidesheim seit dem 1. Januar 1973 die Verbandsgemeinde
Deidesheim. 1974 wurde bei Niederkirchen eine
Gemeinschaftskläranlage für die Ortsgemeinden der
Verbandsgemeinde fertiggestellt und 1978 die
Bezirkssportanlage der Verbandsgemeinde Deidesheim errichtet,
die 1993 um eine Sporthalle ergänzt wurde.
Staatsgäste in Deidesheim
Große
mediale Aufmerksamkeit erlangte Deidesheim durch die Besuche
hoher ausländischer Staatsgäste, die Bundeskanzler Helmut Kohl
zwischen 1989 und 1997 bei Staatsbesuchen nach Deidesheim
einlud. Häufig bekamen die Staatsgäste im Deidesheimer Hof das
Gericht Pfälzer Saumagen serviert. Die Staatsgäste, die mit
Kohl nach Deidesheim kamen, waren die britische
Premierministerin Margaret Thatcher (30. April 1989), der
sowjetische Generalsekretär Michail Gorbatschow (10. November
1990), der kanadische Premierminister Brian Mulroney (16. Juni
1991), der amerikanische Vizepräsident Dan Quayle (9. Februar
1992), der tschechische Präsident Václav Havel (14. Oktober
1993), der russische Präsident Boris Jelzin (12. Mai 1994),
der britische Premierminister John Major (1. Oktober 1994) und
das spanische Königspaar Juan Carlos und Sophia (17. Juli
1997).
Dieser Artikel basiert auf dem Artikel
Deidesheim aus der freien Enzyklopädie Wikipedia.
Der Text ist unter der Lizenz „Creative Commons Attribution/Share Alike“ verfügbar; zusätzliche Bedingungen können anwendbar sein. Einzelheiten sind in den Nutzungsbedingungen beschrieben.
In der Wikipedia ist eine Liste der
Autoren verfügbar. |
